
|
||||||
| Öko-Institut fordert "Instrumentenmix" in der Klimaschutzpolitik | ||||||
| Emissionshandel bringt viele Vorteile, darf aber nicht alleiniges Mittel sein / Institut entwickelt derzeit Grundlagen für den "Nationalen Allokationsplan" | ||||||
Im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelt das Öko-Institut e.V. - in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) sowie dem Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung - derzeit die Grundlagen für den so genannten "Nationalen Allokationsplan" im Rahmen des EU-Emissionshandels.
Der Hintergrund: Im Januar 2005 startet der europäische Handel mit Emissionsrechten für das wichtigste Klimagas Kohlendioxid. Den Unternehmen wird eine begrenzte Menge von Emissionsrechten zugewiesen und diese können dann in eigener Regie entscheiden, ob sie ihre Anlagen modernisieren und somit die Emissionen reduzieren oder ob sie ihre Klimaschutzverpflichtungen durch den Kauf von Emissionsrechten anderer Unternehmen erbringen. Dabei handelt es sich um ein völlig neues Instrument in der deutschen Klimaschutzpolitik. Die Industrie hatte seinerseits zugesagt, ihren Kohlendioxidausstoß bis 2012 um jährlich 45 Millionen Tonnen unter das Niveau von 1998 zu senken.
Das Kernstück des Emissionshandels bildet der "Nationale Allokationsplan", den die Bundesregierung bis zum Frühjahr 2004 zur Notifizierung bei der Europäischen Kommission in Brüssel vorlegen muss. In dem Nationalen Allokationsplan wird sowohl die absolute Menge der ausgegebenen Emissionsrechte (dies entspricht dem Emissionsminderungsziel) als auch die Verteilung der Emissionsrechte auf die einzelnen Anlagen festgelegt. Der Nationale Allokationsplan wird derzeit sehr kontrovers diskutiert.
Das Öko-Institut e.V. hat vor wenigen Tagen eine Studie vorgelegt, die die wirtschaftlichen Folgen des neuen Klimaschutzinstrumentes Emissionshandel auf die deutsche Industrie untersucht. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und der Ecofys GmbH (Köln) hat das Öko-Institut im Auftrag der Umweltstiftung WWF Deutschland eine Vielzahl von Zuteilungsvarianten für die Emissionsrechte untersucht und die Wirkungen auf die verschiedenen Industriezweige detailliert abgeschätzt. Aus dieser umfassenden Analyse (den Datenanhang der Studie umfasst 340 Seiten) lassen sich drei zentrale Schlussfolgerungen ziehen:
1. Der Emissionshandel ist ein sehr wirksames und zugleich kostengünstiges Instrument, um die Klimaschutzziele der Industrie zu erreichen. Im Vergleich zu alternativen Instrumenten wie einer Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft lassen sich jährlich zwischen 230 und 545 Millionen Euro einsparen.
2. Der Emissionshandel bewirkt Verteilungseffekte zwischen den verschiedenen Unternehmen und Branchen. Diese können durch die verschiedenen Zuteilungsmodelle erheblich beeinflusst werden, das herausragende Ausgestaltungsmerkmal ist dabei das Basisjahr auf dessen Grundlage die Emissionsrechte an die einzelnen Anlagen verteilt werden. Allerdings können auch die Verteilungseffekte innerhalb bestimmter Branchen deutlich größer sein als zwischen verschiedenen Branchen. Forderungen nach Sonderregelungen für einzelne Branchen, die mit den Verteilungseffekten begründet werden, sollten also stets sehr kritisch hinterfragt werden. Vorteile zeichnen sich zudem für Branchen ab, die sich lange gegen die Einführung des Emissionshandels gewehrt haben, wie die Chemieindustrie und der Bergbau. Sie können aller Voraussicht nach Emissionsrechte verkaufen, weil sie ihren Kohlendioxidausstoß bereits erheblich verringern konnten.
3. Vor diesem Hintergrund erweisen sich vor allem Transparenz und Einfachheit des Systems als außerordentlich wichtiges Kriterium für die Emissionsrechtezuteilung. Die Vielzahl der geforderten Sonderregelungen sollte auf ein unvermeidliches Mindestmaß reduziert werden.
Mit dem Emissionshandel wird eine neue Etappe in der Klimaschutzpolitik eingeleitet. Für den Erfolg dieses neuen Instruments - von dem auch viele Ausstrahlungseffekte auf den internationalen Klimaschutzprozess erwartet werden - wird entscheidend sein, ob es gelingt, den Emissionshandel unbürokratisch und einfach auszugestalten und gleichzeitig den Unternehmen ambitionierte Emissionsminderungsziele vorzugeben.
Das Öko-Institut e.V. ist das führende Umweltforschungsinstitut im Bereich der angewandten Ökologie. Es erstellt wissenschaftliche Gutachten und berät PolitikerInnen, Umweltverbände, Institutionen und Unternehmen. An den drei Standorten Freiburg, Darmstadt und Berlin beschäftigt das Institut über 100 MitarbeiterInnen, darunter 70 WissenschaftlerInnen.
Die Studie "Auswirkungen des europäischen Emissionshandelssystems auf die deutsche Industrie" sowie der zugehörige Anlagenband sind über die Website des Öko-Institut e.V. (www.oeko.de, Rubrik Download) oder der Umweltstiftung WWF Deutschland (www.wwf.de) kostenlos verfügbar.
Ansprechpartner:
Dr. Felix Christian Matthes, Projektleiter und stellvertretender Geschäftsführer des Öko-Institut e.V., Telefon 030/28 04 86-81 oder 0171/286 46 59
|
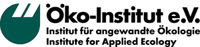 | ||||||
Druckausgabe |