
|
||||||
| Erweiterte Europäische Union: | ||||||
| Öko-Institut e.V. verweist auf Folgen für die Umwelt- und Energiepolitik | ||||||
Zu den großen Problemen gehören nach seiner Einschätzung beispielsweise die Atomkraftwerke russischer Bauart, die in den Beitrittsstaaten betrieben werden. Hierzu zählen die Reaktoren des Tschernobyl-Typs in Litauen, aber auch die Reaktoren in Tschechien, der Slowakei und Ungarn, die den in Ost-Deutschland stillgelegten Kernkraftwerken gleichen. Probleme werden zudem die weiterhin hohen Schadstoffemissionen aus den Kraftwerken und erhebliche Wasserverschmutzungen bereiten, schätzt Matthes die Situation ein.
Die Wirtschaftskraft der meisten Beitrittsstaaten liege erheblich unter den Durchschnittswerten der EU. Dadurch werde den Kosten von Umweltschutz, gerade in Bezug auf die gemeinschaftlichen Ansätze von Umwelt- und Energiepolitik eine neue Bedeutung zukommen. Bei der ökonomisch effizienten Ausgestaltung von umweltpolitischen Instrumenten unter den Vorzeichen knapper Kassen könne hier sogar einiges von den Beitrittsstaaten gelernt werden, sagt Matthes.
Neue Herausforderungen entstehen nach Aussage des Wissenschaftlers zudem bei der Bekämpfung konventioneller Umweltprobleme wie der Luftreinhaltung. Gleichzeitig müsse sich die erweitere Europäische Union mit dem Klimaschutz befassen. Dadurch könnten möglicherweise andere Lösungsansätze auftauchen. "Wird Klimaschutz nicht erst Jahre nach den Bemühungen um den 'klassischen' Umweltschutz, sondern parallel dazu betrieben, können sich viele Maßnahmen einfacher und kostengünstiger gestalten lassen", sagt er
Weitere Folge der größeren EU: Mit den beitretenden Staaten werde sich das Kräftegleichgewicht in der Europäischen Union verschieben. Kohleorientierte Staaten (Deutschland, Spanien, Polen, Tschechien, Ungarn) werden einflussreicher, die Seite der atomkraftbefürwortenden Staaten wird beispielsweise mit Tschechien maßgeblich gestärkt. Eine EU-Politik, die bisher die Förderung der Kernenergie abbaut und Subventionen für umweltbelastende fossile Brennstoffe eliminiert, werde dadurch ganz sicher nicht einfacher, sagt der Wissenschaftler
Das Öko-Institut beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Entwicklung der europäischen Politik wie dem europäischen Emissionshandel, der Zukunft des Euratom-Vertrages und den verschiedenen Facetten des liberalisierten Energiemarktes. Gleichzeitig hat das Institut in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Projekten in oder mit den Beitrittsstaaten durchgeführt.
Eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre sieht das Öko-Institut darin, die Erfahrungen aus diesen beiden Arbeitsbereichen zu nutzen, um sich für eine stärkere europäische Umwelt- und Energiepolitik einzusetzen.
Weitere aktuelle Informationen stehen Ihnen unter www.oeko.de in der Rubrik Presse/Pressemitteilungen zum Download zur Verfügung.
|
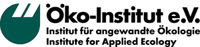 | ||||||
Druckausgabe |