
|
||||||
| Langzeitbeobachtung von gentechnisch veränderten Pflanzen ist unverzichtbar | ||||||
| Umweltressort legt Vorschläge für Monitoring-Konzept vor | ||||||
Bundesumweltminister Jürgen Trittin: "Die Verabschiedung der neuen EG-Freisetzungsrichtlinie ist ein bedeutender Schritt hin zu einem verantwortungsvollen, vorsorgenden Umgang mit der Grünen Gentechnik. Mit den neuen Regelungen wird der Schutz für Mensch und Umwelt deutlich erhöht und die Beteiligung der Öffentlichkeit gestärkt. Das Langzeitmonitoring ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer vorsorgenden Umweltpolitik. Um einzelne Bestimmungen dieser Richtlinie wirksam umsetzen zu können, ist aber auch eine Verordnung über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen in Lebens- und Futtermitteln eine wesentliche Voraussetzung."
Mit der neuen EG-Freisetzungsrichtlinie werden die Vorgaben für den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen verschärft. Genehmigungen werden nur noch befristet für zehn Jahre erteilt und können auch vorzeitig widerrufen werden. Die umstrittenen Antibiotikaresistenzgene dürfen schrittweise nicht mehr verwendet werden. Um die Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung zu verbessern, sollen ein Gen- und ein Anbauregister aufgebaut werden. Außerdem muss nach der Marktzulassung gentechnisch veränderter Pflanzen ein Langzeitmonitoring durchgeführt werden. Damit sollen negative Folgen rechtzeitig erkannt und ihnen gegengesteuert werden.
UBA-Präsident Prof. Dr. Andreas Troge: "Das Monitoring wird zusätzliche Sicherheit schaffen. Wir müssen schrittweise aus Erfahrungen lernen. Zwar haben gentechnisch veränderte Pflanzen zum Zeitpunkt ihrer Marktzulassung bereits eine Risikoschätzung und eine Reihe von Tests durchlaufen. Aber aus der
Forschung häufen sich mittlerweile die Hinweise, dass gentechnisch veränderte Pflanzen durchaus zu Umweltproblemen führen können. Auch über ihre langfristigen und ihre indirekten Wirkungen auf Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit ist noch viel zu wenig bekannt. Die biologische Vielfalt darf durch den Einsatz der Gentechnik nicht gefährdet werden."
Auf dem vom UBA organisierten Symposium "Monitoring von gentechnisch veränderten Pflanzen: Instrument einer vorsorgenden Umweltpolitik" werden die vom Bundesumweltministerium erarbeiteten Vorschläge für ein Monitoring-Konzept einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert. An der Veranstaltung nehmen Vertreter von Politik, Forschung, Wirtschaft, Behörden und Umweltverbänden teil. Die Regierungsfraktionen hatten 1998 vereinbart, dass der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in einem Langzeitmonitoring wissenschaftlich begleitet werden müsse. Seitdem hat das Bundesumweltministerium zahlreiche Aktivitäten entfaltet. Unter anderem beschäftigt sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit den Grundlagen der Konzeptentwicklung. Es wurde auch ein umfangreiches Forschungsvorhaben dazu vergeben, das demnächst abgeschlossen sein wird.
Neben der neuen EG-Freisetzungsrichtlinie hat die EU-Kommission auch zwei Verordnungsvorschläge zur Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und über gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel vorgelegt. Bundesumweltminister Trittin: "Neben Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung brauchen wir auch Wahlfreiheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein deutliche und klare Kennzeichnung von Produkten mit gentechnisch veränderten Organismen und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ihres Produktionsweges. Die vorgelegten Vorschläge gehen in die richtige Richtung. Ich werde mich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass wir schnell zu einer EU-weiten Regelung kommen werden." Danach wird zu entscheiden sein, von welcher Behörde des BMU das Monitoring durchgeführt werden soll.
In einer jüngst veröffentlichten EU-Studie ist durchgerechnet worden, welche Kosten auf die Landwirtschaft zu kommen, wenn ein Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen neben konventionellem und Ökolandbau stattfindet. Das Ergebnis der Studie ist, dass es selbst bei einer maßvollen Einführung der transgenen Sorten sehr schwer werden wird, Verunreinigungen zu vermeiden. Diese Gefahr kann durch entsprechende Maßnahmen verringert werden, allerdings nur mit einem hohen finanziellen Aufwand. Bundesumweltminister Trittin betonte, dass der Preis für die Nutzung der Grünen Gentechnik nicht von denen getragen werden könne, die konventionell wirtschaften und erst recht nicht von denen, die einen umweltgerechten Ökolandbau betreiben. Vielmehr sei der Preis von denen zu tragen, die die Technik nutzen wollen. Auch hier müsse das Verursacherprinzip zum Tragen kommen.
Berlin, den 13.06.2002
|
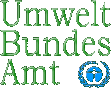 | ||||||
Druckausgabe |