
|
||||||
| Politische Ökologie: Die Suche nach der guten Gesellschaft | ||||||
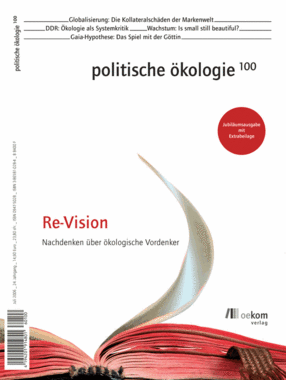 Der Name ist Programm. Die Politische Ökologie verbindet Umwelt- konsequent mit Gesellschaftsfragen. Ökologie wird politisch und Politik wird ökologisch. Die konkreten Vorstellungen sind alles andere als einheitlich. Die Palette reicht von Graswurzel-Ansätzen über ganzheitliche Wissenschaft bis zu globalen Managementsystemen. Eine Skizze ökologischer Visionen.
Der Name ist Programm. Die Politische Ökologie verbindet Umwelt- konsequent mit Gesellschaftsfragen. Ökologie wird politisch und Politik wird ökologisch. Die konkreten Vorstellungen sind alles andere als einheitlich. Die Palette reicht von Graswurzel-Ansätzen über ganzheitliche Wissenschaft bis zu globalen Managementsystemen. Eine Skizze ökologischer Visionen.
Das Auffälligste am Ökodiskurs ist sein kontroverser Charakter. Ganz unterschiedliche Gesellschaftskonzepte werden angedacht und propagiert, was teils zu lähmenden Widersprüchen, teils zu produktiven Irritationen führt. Die einen setzen auf mehr Aufklärung und technologische Innovation, andere sind vom technikkritischen "Antiplastikreflex" (1) und romantischen Naturidealen geprägt. Neben Modellen einer Ökodiktatur oder einer starken Weltregierung finden sich Ideen zu einer ökologisch motivierten Graswurzel-Demokratie. Neben einer vollständigen Verdammung des freien Marktes als ökologischer Ursünde wird ein Ökokapitalismus propagiert. Im Ganzen sind die Umweltkrise und die als Reaktion darauf entstandenen Weltanschauungen und Bewegungen "Ausdruck einer Moderne, die im Zuge der Globalisierung und durch die ,Zurückgeworfenheit auf sich selbst' an ihre eigenen Grenzen stößt". (2)
Drei Phasen des Ökodiskurses verkörpern drei sich wechselseitig ergänzende Aspekte: die radikale Gesellschaftskritik, der Pragmatismus von Technisierung und Institutionalisierung sowie die Integration in umfassende Konzepte globaler Wohlstandssicherung. Die drei Grundmodelle des ökologischen Diskurses legen je eigene Schwerpunkte, von denen keiner für sich allein hinreichend, aber auch keiner verzichtbar ist.
Apokalypse des Wirtschaftswunders
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich die Politische Ökologie zunächst als eine neue Variante einer kritischen Theorie der Gesellschaft etabliert - und liest sich häufig wie eine Transformation der "Dialektik der Aufklärung" von Horkheimer und Adorno. (3) Deren Vorwurf, dass die instrumentelle Vernunft auf Sinn verzichte, in blinde Herrschaft verstrickt sei und durch den objektivierend-pragmatischen Zugriff auf die Natur auch den Menschen verdingliche, wurde zu einem Standardargument der Umweltbewegung. Die Folge war und ist eine radikale Kritik des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der einseitig das Verfügungswissen vergrößere und der aus Mangel an Orientierungs- und Sinnwissen in ein zielloses Streben münde.
Im Unterschied dazu blieb etwa die Umweltbewegung in Frankreich unpolitisch und wertkonservativ. In den USA dominiert das Leitbild Wildnis, was zu einer völlig anderen Grundstimmung führt. In der DDR wiederum, wo eine direkt gesellschaftskritische Umweltbewegung gar nicht möglich war, entfaltete sie sich im Schutzraum der Objektivität und (scheinbaren) Neutralität naturwissenschaftlicher Forschung sowie teilweise in einem kirchlichen Rahmen (vgl. S. 50 ff.).
Mit dem gesellschaftskritischen Ton entwickelte sich die Ökologie in Deutschland zugleich zu einem Katastrophen- und Anklagediskurs. In apokalyptischen Bildern wurde der drohende Untergang der Menschheit geschildert. Dem Rezept des Wirtschaftswunders, das das Nachkriegsdeutschland maßgeblich geprägt hatte, wurden "Die Grenzen des Wachstums" (Club of Rome, 1972) entgegengesetzt (vgl. S. 18 ff.). Die Ölkrise Mitte der 1970er-Jahre machte die zuvor ungeahnten Grenzen konkret erfahrbar. Autofreie Sonntage, eine staatliche Maßnahme, um die nationalen Ölreserven zu schonen, nahm die Umweltbewegung äußerst positiv auf. Auf leeren Autobahnen Rad zu fahren, war ein Symbol für die neue Vision einer Gesellschaft, in der nicht Tempo und Effizienz des Arbeitslebens, sondern das Kleinräumige und Private den Rhythmus bestimmen.
Die ökologisch begründeten Grenzen des Wachstums führten zu neuen Antworten auf die Sinn- und Lebensfragen, die von ihren Kritikern als hedonistisch, in der Soziologie meist als postmaterialistisch beschrieben werden. Die neuen Wertmuster berührten auch die Stellung des Menschen im Kosmos: Der Mensch solle sich wieder bewusst werden, dass er in das zerbrechliche Geflecht des Ökosystems Erde eingebunden sei und dem als moralische Norm verstandenen ökologischen Gleichgewicht Respekt erweisen. E. Schumachers "Small is beautiful" (der Titel ist eine Abwandlung des Anti-Apartheidsmottos "black is beautiful") wurde zum Lebensstil- und Sinnkonzept (vgl. S. 24 ff.).
Der Wertewandel beruhte auf einer wesentlichen Voraussetzung: Der Wohlstand war gesichert. Man konnte auf einem hohen Niveau Verzicht und Neuorientierung fordern. Eine postmaterialistische Lebensausrichtung war möglich, weil es im Unterschied zur Nachkriegszeit und angesichts von Vollbeschäftigung nicht mehr so vordringlich schien, sich um die wirtschaftliche Existenzsicherung zu sorgen. Die Politische Ökologie wurde zum Emanzipationsdiskurs der heranwachsenden Generation aus oberen Gesellschaftsschichten.
Alternative Wissenschaft und New Age
Zugleich veränderte die Arbeit an ökologischen Themen im Rahmen naturwissenschaftlicher Forschung ihre Methoden und Paradigmen. Die Natur wurde als ein vernetztes System betrachtet, das ein entsprechendes Denken in Beziehungen erfordert, welches Nichtlinearität, kybernetische Rückkoppelungsschleifen oder Ordnungsbildung in gleichgewichtsfernen Zuständen zu erfassen im Stande ist. Auf dieser Basis entwickelte sich eine "alternative Wissenschaft", die in Absetzung vom neuzeitlichen positivistischen Ansatz die Wissenschaft für Wertfragen sensibilisieren wollte und teilweise - wie etwa im Gaia-Konzept von James Lovelock (vgl. S. 32 ff.) - mit einem schillernden Lebensbegriff operiert. Parallel dazu öffneten sich Teile der Umweltbewegung der religiösen oder esoterischen Dimension. Meist in Absetzung gegen die christliche Anthropozentrik und Desakralisierung der Natur wurde die Ökobewegung zur führenden Vermittlerin der New-Age-Bewegung.
Früh gab es enge Verbindungen zwischen der Umwelt- und der Friedensbewegung: Bei den Ostermärschen, die in den siebziger Jahren zum Ausdruck einer neuen Bürgerbewegung wurden, demonstrierten ihre Repräsentant(inn)en unter dem gemeinsamen Dach einer gesellschaftskritischen "Zukunftsverantwortung". Die ökologisch motivierte Gesellschaftskritik war die Kehrseite einer umfassenden Utopie von Frieden und Harmonie zwischen Menschen und Lebewesen.
Gutachten statt Manifeste
Die 68er-Bewegung startete ihren Marsch durch die Institutionen, und mit ihr auch der ökologische Diskurs. Ein erster Bewusstwerdungsprozess war angelaufen, ökologische Probleme und Gefahren waren als politische und wissenschaftliche Herausforderungen erkannt. Und in eben dieser Weise reagierte die Gesellschaft seit den achtziger Jahren darauf: pragmatisch. Es wurden Institutionen geschaffen, die sich mit dieser Problematik befassen sollten, so etwa 1986 das Bundesumweltministerium als Reaktion auf das Reaktorunglück in Tschernobyl.
Teile der Umweltbewegung institutionalisierten sich in der Gestalt einer Partei: den Grünen, die zumindest auf Landesebene ziemlich schnell regierungsfähig wurden. Damit gelangten die Forderungen des so genannten linken Lagers in die gesellschaftliche Mitte, doch verloren sie dabei an Schärfe, die grünen Idealisten mussten Kompromisse eingehen, wurden bürgerlich. Maximalforderungen wurden auf ein allgemein durchsetzbares Mindestmaß heruntergeschraubt. Der Konflikt zwischen Realos und Fundis prägt die Debatte der Grünen bis heute.
Neben dieser politischen Institutionalisierung galt Umweltschutz primär als eine Frage von Forschung und Technik. Dies hatte Konsequenzen für den ökologischen Diskurs. Es wurde erkannt, dass die Umweltproblematik in vielen Fällen ein Wahrnehmungsproblem ist. Zahlreiche Gefahren entgehen der Sinneswahrnehmung, und nicht wenige Folgen zeigen sich erst mit deutlicher Verzögerung oder in großer räumlicher Entfernung. Der Umweltdiskurs entwickelte sich zu einem wissenschaftlichen Fachdiskurs, in dem sich eine gewisse Expertokratie etablierte. Gutachterinnen und Gegengutachter bestimmten die Sicht der Wirklichkeit.
Die Publikationen zu Umweltthemen nahmen zu. Es handelt sich aber nicht mehr um Aufrufe und Manifeste, sondern um wissenschaftliche Stellungnahmen, meist ausgewogene und folglich prinzipiell konsensfähige Empfehlungen oder akribische Berichte. Beispiele sind der Brundtland-Bericht von 1987 (vgl. S. 46 ff.) sowie die Umweltgutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen, der ab 1987 alle zwei Jahre erscheint. Das emanzipatorisch-partizipative Element der siebziger Jahre ging durch die Professionalisierung weitgehend verloren.
Umweltprobleme sollten auf technischem Weg gelöst werden. Exemplarisch dafür stehen Katalysator und bleifreies Benzin. Technologische Innovationen initiierten vielfältige und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Umwelt. Damit hatte die ökologische Bewegung einerseits wichtige Ziele erreicht, andererseits ihr Wesen grundlegend verändert. Die Natur wurde allmählich wirksam geschützt, aber der mit dem Ruf "Zurück zur Natur" verbundene Bewussteins- und Lebensstilwandel hatte sich kaum eingestellt. Vielmehr schien er aufgrund der neuen Technologien fast schon überflüssig. Der Umweltdiskurs verlor seine radikal-gesellschaftskritische Kraft. Er war eines von vielen Politikfeldern. Zugleich wuchs der Glaube, die Gesellschaft durch rational-technische Maßnahmen in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zukunftsfähig machen zu können, ohne eine Wertedebatte führen zu müssen.
Ökologie mit Nebenwirkungen
Ein weiteres Kennzeichen des ökologischen Diskurses seit den späten achtziger Jahren ist die Reflexivierung. Diesen Begriff verwendet Ulrich Beck in dem Buch "Risikogesellschaft" (vgl. S. 41 ff.) zunächst in gesellschaftstheoretischer Hinsicht, um die Weiterentwicklung der modernen Gesellschaft von der ersten in die zweite Moderne, die vollständig oder eben reflexiv modern ist, eine Gesellschaft, die gleichsam um ihre Modernität weiß. Sie ist allem voran eine Risikogesellschaft. Sie hat das Bewusstsein verinnerlicht, dass jede Handlung Nebenfolgen und Nebenfolgen von Nebenfolgen zeitigt, die nicht mehr absehbar sind. Dieser Grundsatz betrifft auch ökologische und soziale Entscheidungen: Sie verlieren ihren Anspruch, per se gut zu sein.
Der Vorgang der Reflexivierung besitzt eine doppelte Bedeutung für den ökologischen Diskurs: Zum einen ist weitgehend anerkannt, dass die Umweltproblematik die Gesellschaft fundamental betrifft und dass die Gesellschaft dementsprechend handeln und sich auch selbst verändern muss. Zum anderen hat die Erfahrung gezeigt, dass lineare Planungen und Eingriffe in Natur und Gesellschaft ungeahnte Nebenfolgen hervorrufen. Die Ökologiebewegung mag zwar noch beanspruchen können, dass sie weiß, was falsch läuft; doch die Gesellschaft gesteht ihr nicht mehr automatisch zu, dass sie auch weiß, welches der richtige Weg ist.
In dieser Situation schlug der ökologische Diskurs einen neuen Ton an, er wurde sachlicher und bemühte sich um Verzicht auf moralische Untertöne. Die kritisch distanzierte Betrachtung der Ambivalenzen "ökologischer Kommunikation" (Niklas Luhmann, 1986) bestimmte die Debatte (vgl. S. 41 ff.).
In den neunziger Jahren etablierte sich der ökologische Diskurs endgültig auf globaler Ebene. Ozonloch und Klimawandel führten deutlich vor Augen, dass Umweltzerstörung und Naturschutz die ganze Menschheit betreffen. Dementsprechend forderte Ernst Ulrich von Weizsäcker eine "Erdpolitik". (4) Zugleich traten die sozialen und ökonomischen Facetten der Umweltproblematik stärker ins Bewusstsein. In den Entwicklungsländern ist Armut gleichermaßen Folge wie Ursache von Umweltzerstörung. In den Industrieländern scheinen sich ökologische und soziale Ansprüche entgegenzustehen: Umweltschutz koste Arbeitsplätze, so ein häufig zu hörender Vorwurf. Gegen diesen Angriff können sich die Umweltschützer(innen) nicht mehr wie zuvor mit Grundsatzdebatten verteidigen, sondern allein mit pragmatischen und integrativen Konzepten. Nachhaltigkeit ist hierfür derzeit das stärkste.
Welthandel überrollt Erdgipfel
Angesichts der globalen Herausforderungen versuchte sich die Weltgemeinschaft in globalen Institutionen und Gipfeltreffen auf einen gemeinsamen zukunftsfähigen Weg zu verständigen. 1988 gründeten sie den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen. Maßgebend war und ist der Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992 mit seinen wegweisenden Dokumenten: der Rio-Deklaration, den Konventionen über Klima und über biologische Vielfalt sowie der Agenda 21, die in ihrer Bedeutung als neuer Gesellschaftsvertrag für das 21. Jahrhundert zuweilen mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 verglichen werden. Die dabei zu Grunde gelegte Gesellschaftsvision ist die einer weltweiten Partnerschaft für Umwelt und Entwicklung, die an die Stelle des 1989 überwundenen Ost-West-Konfliktes treten sollte. Inhaltlich geht es um die Vernetzung ökologischer, ökonomischer und sozialer Anliegen, durch die sich Umweltpolitik vom nachsorgenden Reparaturbetrieb zur vorsorgenden Zukunftspolitik wandeln soll.
Die Bilanz des Erreichten fiel 2002 auf der Nachfolgekonferenz "Rio+10" in Johannesburg ernüchternd aus: Eine Trendwende wurde nicht erreicht. Aufgrund der drängenden Armuts- und Arbeitslosenproblematik scheint es kaum Spielraum für ökologische Vorsorge zu geben. Die Entwicklung der Weltgesellschaft wird seit den neunziger Jahren vom globalen Wettbewerb unter der Regie der 1995 gegründeten Welthandelsorganisation und der Weltbank bestimmt.
Sammelbecken Nachhaltigkeit
Unter dem Eindruck dieser Enttäuschung kehrt im Ökodiskurs die Variante der radikalen Ökonomie- und Gesellschaftskritik zurück - nun in der Form von Globalisierungskritik. Deren pulsierendes Herzstück ist das schnell wachsende Attac-Netzwerk, das in neuer Weise eine ganze Bandbreite unterschiedlicher ökosozialer Gesellschaftskritik zu vereinen vermag. Die Vorstellung einer globalen Zivilgesellschaft als eines gleichberechtigten oder gar vorgeordneten Verantwortungsträgers neben Politik und Wirtschaft sowie die Suche nach neuen Konzepten für eine "Demokratisierung der Demokratie" (5) treten in den Vordergrund.
Über den Umweg der Globalisierung hat der Umweltdiskurs wichtige Aspekte seines ursprünglichen gesellschaftskritischen und emanzipatorischen Impetus wieder gefunden. Zugleich sind durch seine Einbindung in den Nachhaltigkeitsdiskurs bereits weit reichende Weichen Richtung pragmatische Institutionalisierung, Technisierung und ökonomische Steuerung gestellt. Denn das Modell der Nachhaltigkeit verbindet - zumindest in den offiziellen politischen Varianten - gezielt marktwirtschaftliche und ökologische Elemente im Sinne einer ökosozialen Marktwirtschaft. Besonders deutlich wird dies im Konzept des Global Marshallplans. (6)
In gesellschaftstheoretischer Hinsicht ist das Konzept der Nachhaltigkeit, in dem sich die Anliegen der Umwelt- und Eine-Welt-Bewegung, der internationalen Politik, der Ökologischen Ökonomie sowie einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Initiativen bündeln, derzeit die profilierteste gesellschaftstheoretische Zukunftsvision. In ethische Kategorien übersetzt meint Nachhaltigkeit globale und intergenerationelle Gerechtigkeit. Dies in ein politisches Aktionsprogramm mit Querschnittscharakter umzusetzen, ist der hohe Anspruch der aktuellen Politischen Ökologie, die jedoch gerade unter der großen Bandbreite von Anliegen und Initiativen leidet, die sich unter dem Dach der Nachhaltigkeit zusammenfinden und sich infolge ihrer Heterogenität häufig wechselseitig blockieren.
Revolutionäre Kraft oder Pragmatismus
Nachhaltigkeit ist eigentlich eher ein Konflikt- denn ein Harmoniemodell. Im Zentrum des Konfliktes steht die Diskussion um Reichweite, Grenzen und Weiterentwicklung einer Ökologischen Ökonomie (vgl. S. 56 ff.). Diese betrachtet in ressourcenökonomischer Sicht die Wirtschaft als Subsystem der Ökologie, weil sie zunehmend von der systemischen Erhaltung und Optimierung ihrer Ressourcenbasis abhängig ist. Wirtschaftliche Entwicklung und Umweltverbrauch sind voneinander zu entkoppeln. Deshalb sollen sich die ökologischen Kosten für Entwicklung, Produktion, Transport oder Entsorgung in dem Preis eines Produktes wieder finden. Das wird unter dem Stichwort "Kostenwahrheit" diskutiert. Sie soll verhindern, dass die Allgemeinheit die ökologischen Folgekosten umweltschädlicher Produktion trägt. Dies kann nur auf der Basis eines neuen Wohlstandsmodells gelingen, das nicht Produktion und Konsum maximiert, sondern versucht die Lebensqualität zu optimieren. Zu einem hohen Lebensstandard gehören auch öffentliche Güter wie Sicherheit, saubere Luft und sauberes Wasser, schöne Landschaften, gesunde Nahrungsmittel, öffentliche Verkehrsmittel, Bildung oder Partizipation. Regionalisierung wird als ein Weg diskutiert, der Ressourcen schont und Lebensqualität durch Nähe verspricht.
Die Ökologische Ökonomie im Anspruch der Nachhaltigkeit erkennt die positiven Leistungen der Marktwirtschaft an und gesteht dem Ökonomischen auch einen gewissen Vorrang bei der Gestaltung der Gesellschaft zu. Sie distanziert sich jedoch von der Utopie eines globalen Managementansatzes, der vorgibt, dass sich alle Probleme durch eine entsprechende Sozialtechnologie lösen lassen. Die Rio-Dokumente bevorzugen teilweise das Trickle-down-Konzept. Dies besagt, dass zuerst Wohlstand erwirtschaftet werden muss, um dann die Überschüsse für ökosoziale Zwecke verwenden zu können. Aufgrund akuter Probleme gelingt dies nur unzureichend. Das Trickle-down-Konzept basiert auf veralteten gesellschaftlichen Annahmen aus den achtziger Jahren. Es wurde dennoch ungefiltert in das Konzept der Nachhaltigkeit übernommen. Damit ist der Nachhaltigkeitsgedanke selbst in seiner Zukunftsfähigkeit gefährdet.
Im ethischen Prinzip der Nachhaltigkeit bündeln sich unterschiedliche Visionen einer guten, gerechten und global zukunftsfähigen Gesellschaft. Seine Anziehungskraft beruht auf der Verbindung kritisch-visionärer Elemente mit realistisch-pragmatischen Handlungskonzepten. Zum Teil führt jedoch gerade dies zu einer Verflachung und lähmenden Indifferenz. Der Beweis für die revolutionäre Kraft der Vision Nachhaltigkeit ist noch nicht erbracht.
Fortschritt durch Ökologie?
Der kurze Rückblick auf den ökologischen Diskurs macht deutlich, dass Umweltprobleme die Gesellschaft im Inneren betreffen und insofern immer auch politisch sind. Nur wenn die Umwelt nicht als eine der Gesellschaft äußere Grenze verstanden wird, sondern als eine innere Frage von Lebensqualität und Gerechtigkeit, wenn sie also nicht als Störfaktor, sondern als Zielgröße gesellschaftlicher Entwicklung anerkannt wird, kann es gelingen, das Konzept einer nachsorgenden Umweltpolitik zu überwinden und das Potenzial der Politischen Ökologie zur Zukunftsgestaltung der Gesellschaft auszuschöpfen.
Der ökologische Diskurs zeigt ein vielschichtiges Wechselspiel zwischen Visionen und Re-Visionen der guten Gesellschaft. Vorstellungen einer besseren Gesellschaft entstehen und reifen im Rückblick darauf, was aus den Visionen frühere Zeiten geworden ist. Das Maß der Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft steht in einem engen Zusammenhang zum Maß ihrer Erinnerungsfähigkeit; denn diese ermöglicht, aus den Erfahrungen der Geschichte und den in der Natur erprobten Ordnungen für die Zukunft zu lernen. Wenn Politische Ökologie in diesem Sinne konservativ bewahrende und progressiv erneuernde Elemente als innere Einheit versteht, befähigt sie zu einem Fortschritt mit Maß.
Anmerkungen
(1) Maxeiner, Dirk/Miersch, Michael (1996): Öko-Optimismus. 3. Aufl., Düsseldorf-München, S. 141.
(2) Giddens, Anthony (1997): Jenseits von Links und Rechts. Frankfurt am M., S. 31.
(3) Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1947): Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente. Amsterdam.
(4) Weizsäcker, Ernst Ulrich v. (1989): Erdpolitik: ökologische Realpolitik an der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt. Darmstadt.
(5) Giddens, Anthony (1997): Jenseits von Links und Rechts. Frankfurt am M., S. 149-185.
(6) Radermacher, Franz Josef (2004): Global Mar-shallplan. A Planetary Contract. Für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft. Wien.
Kontakt:
Prof. Dr. Markus Vogt
Philosophisch-Theologische Hochschule
Institut für systematische Theologie
E-Mail vogt@pth-bb.de
www.pth-bb.de
Jochen Ostheimer
Kath. Universitätsgemeinde
E-Mail jochen.ostheimer@unibas.ch
Erschienen in politische ökologie 100
www.oekom.de/nc/zeitschriften/politische-oekologie/aktuelles-heft.html
|
|||||||
Druckausgabe |