
| Corporate Social Responsibility (CSR) im Tourismus |
| Corporate Social Responsibility beschreibt die freiwillige Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen. |
Aktuelles
Eine globalisierte Wertschöpfungskette führt dazu, dass wirtschaftliche Akteure zunehmend die nationalen Grenzen und damit nationale Regelungsmechanismen überschreiten. Sie haben damit einen zunehmenden Einfluss auf Entwicklungsprozesse im Süden.
Während es auf der nationalen bzw. europäischen Ebene klar formulierte Regelungen zum Schutz von Umwelt, ArbeitnehmerInnen und Gesellschaft gibt, fehlen im transnationalen Raum die Spielregeln. Internationale Institutionen wie die UN, die OECD oder die EU haben hierzu eine Reihe freiwilliger Verhaltenskodizes ausgearbeitet, die unter dem Schlagwort Corporate Social Responsibility (CSR) zusammengefasst werden können.
Warum ist CSR notwendig?
"So geht die Menschheit südlich des Äquators" von Nildão (Brasilien)
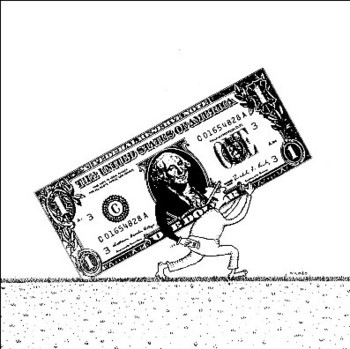
Nach wie vor gibt es im und durch den weltweiten Tourismus soziale Benachteiligung und Umweltzerstörung. Beispiele, wie wenig die genannten und auch ungenannten Konzepte fruchten, lassen sich beispielsweise an der Situation der Frauen im Touristikbereich aufzeigen. So sind laut neuesten Schätzungen der ILO an die 70% der Beschäftigten im Tourismus Frauen. Die Tourismusverantwortlichen betonen häufig, welche Chancen der Tourismus gerade den Frauen eröffnet. Jedoch ist auch dieser Sektor keine Ausnahme: weltweit verdienen Frauen durchschnittlich 20-30% weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen in gleicher Stellung. Zudem sind Frauen in allen Bereichen der persönlichen Dienstleistungen der Gefahr von sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Prostitution ist oft der (vermeintliche) Ausweg aus der Armut, zumal die Sexindustrie in den Tourismusgebieten der Entwicklungs-, aber auch der Transitionsländer besonders boomt.
Kinderarbeit im Tourismus
Auch Kinder sind von den Entwicklungen des Tourismussektors positiv wie negativ betroffen. Oft müssen in touristischen Gebieten auch Kinder früh für ihre Existenzsicherung sorgen und helfen, ihre Familien zu ernähren: dreizehn bis neunzehn Millionen Kinder und Jugendliche unter achtzehn Jahren sind gemäß Schätzungen der ILO im Tourismus beschäftigt. Kinderarbeit hat damit einen Anteil von mindestens 10% des formellen touristischen Arbeitsmarktes, und die neuesten Trends weisen auf eine Zunahme hin. Zieht man weiter den informellen Sektor in Betracht, so dürfte die Zahl der im Tourismus tätigen Kinder und Jugendlichen noch viel höher liegen. Eine Studie des Arbeitskreises Tourismus & Entwicklung (Basel) zeigt, dass Mädchen und Jungen aller Altersstufen in den unterschiedlichsten Arbeitssituationen im Tourismus anzutreffen sind, auch in den Industrieländern. Zwar arbeiten nicht alle jungen Beschäftigten im Tourismus in ausbeuterischen Verhältnissen. Doch viele Millionen Kinder und Jugendliche werden durch ihren Job im Tourismus am Schulbesuch gehindert. Sie müssen oft harte, gefährliche Arbeit für wenig oder gar keinen Lohn verrichten und haben häufig keine Chance auf berufliche Ausbildung. Viele der Arbeitssituationen von Kindern und Jugendlichen im Tourismus sind zu den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu rechnen, die laut der neuen Konvention der ILO zum Schutz der Kinder (Convention Concerning the Prohibition and Immediate Elimination of the Worst Forms of Child Labour, N° 182) vorrangig bekämpft werden müssen.
Zu den schlimmsten Formen der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zählt die kommerzielle sexuelle Ausbeutung, der vorsichtigen Schätzungen der UNICEF zufolge eine Million Kinder und Jugendliche weltweit jährlich neu zum Opfer fallen. Die illegalen Geschäfte mit Kindern florieren in vielen Ländern. Verbrecherringe verdienen mit Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kinderhandel Milliarden. Die touristische Infrastruktur wird gezielt für diese Verbrechen genutzt; Reisende missbrauchen Kinder in den Tourismusdestinationen unter Ausnutzung der günstigen Flug- und Urlaubsangebote. Die erwähnte Initiative zu Verhaltenskodizes von ECPAT zusammen mit internationalen Reiseveranstaltern gelten als gutes Beispiel einer Zusammenarbeit, wenngleich der Kampf gegen Sextourismus noch lange nicht gewonnen ist.
 Immer schlechtere Arbeitsbedingungen im Tourismussektor
Immer schlechtere Arbeitsbedingungen im Tourismussektor
Auch die Arbeitsbedingungen der im Tourismusbereich Beschäftigten leiden unter den jüngsten Entwicklungen. Im Zuge der Liberalisierung der Märkte und mit dem Abschluss der Dienstleistungsabkommen (GATS) 1994 im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO-OMC) wurden privaten Tourismusunternehmen weitreichende Rechte zugestanden, ohne dass ihnen entsprechende Pflichten auferlegt wurden. Zwar haben Hotel-, Transport- und Reisegesellschaften über die letzten Jahre in zunehmender Zahl so genannte »voluntary initiatives« (Selbstverpflichtungen) unterschrieben, mit denen sie meist ein ökologisch verträglicheres Wirtschaften anstreben. Das ist wichtig, insbesondere auch für transnationale Unternehmen, die sich nationalstaatlichen Regulierungen leichter entziehen können. Vor allem aber wird in den Selbstverpflichtungen des Privatsektors die soziale Dimension der Nachhaltigkeit vernachlässigt. So hätten sich in privatisierten, oft von internationalen Ketten übernommenen Hotels verschiedener Länder die Arbeitsbedingungen klar verschlechtert, ohne dass den Angestellten gewerkschaftliche Organisation zugestanden wird, beklagten Delegierte an der ILO-Tagung über die Auswirkungen der Globalisierung auf den touristischen Arbeitsmarkt vom April 2001.
Die unvollständige Aufzählung bereits bestehender Konzepte zeigt, dass es zwar einerseits in der Vergangenheit eine Vielzahl von Initiativen von staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Seite gab, diese andererseits häufig nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Ein Grund dafür ist die mangelnde Verständigung unter den europäischen und internationalen Akteuren über die Ausgestaltung. Häufig werden Richtlinien ohne Konsultation und Dialog verfasst. Verbindliche und weitreichend anerkannte CSR-Richtlinien im Touristikbereich fehlen ebenso, wie verbindliche Kontrollmechanismen. Hier soll der Blick zu Wirtschaftsbranchen helfen, die in der Entwicklung gemeinsamer CSR-Richtlinien bereits Erfolge in der Verankerung dieser haben. Auch kann der Ansatz der im August 2003 von der UN-Menschenrechtskommission verabschiedeten Normen für Unternehmer miteinbezogen werden.
| Druckausgabe |