
| Menschen und Visionen: Tapio Mattlar |
| Portrait-Serie: Träger des alternativen Nobelpreises |
Magazin
Tapio Mattlar
gehört zu den Aktivisten der finnischen Dorferneuerungs-Bewegung. Angesichts der massiven Abwanderung in die Städte entstanden durch die 'Finnish Village Action/Kylatoiminta' Dorfkomitees, die sich zu Kernzellen eines neuen regionalen Selbstbewusstseins mit zahlreichen kulturellen und politischen Aktivitäten entwickelten und die Landflucht bremsen konnten. Er erhielt den Alternativen Nobelpreis 1992.
Die Macht des Lokalen- Dorfaktivisten in Europas Norden
Praktisch alle Modelle für eine eigenständige Entwicklung in der 'Ersten' und der 'Dritten Welt', die seit 1980 mit dem 'Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurden, zielen im Kern auf eine Wiederbelebung regionaler Gemeinschaften, die Neuentdeckung traditionellen lokalen Wissens, die Rückbesinnung auf eigene spirituelle Werte, Methoden kleinräumigen und selbstversorgenden Wirtschaftens, gegenseitige Kooperation und Basisdemokratie. Die daraus entstehende Bewegung der 'Dorf-Aktivisten' für eine selbstbestimmte Entwicklung, ländliche Identität und kulturelles Selbstbewusstsein war stark genug, um bis in die 'entwickelte Welt' des Nordens zum Vorbild zu werden.
Schon zu Beginn der 70er Jahre bildeten sich im europäischen Norden, in Finnland, sogenannte 'Dorf-Komitees', um die Welle der Abwanderung in die Städte zu bremsen. In weniger als 10 Jahren wuchs ihre Zahl von 50 auf 2000. Ende der 90er Jahre gab es in drei Viertel der finnischen Dörfer Komitees des 'Finish Village Action Network' (RLA 1992), in denen mehr als 30.000 Menschen mitarbeiteten und die Lebensbedingungen von einer halben Million Menschen beeinflussten. Unter dem Motto 'Wir kämpfen nicht gegen Windmühlen, sondern für sie' engagierten sich die Komitees dieser größten finnischen Volksbewegung für die Erhaltung der traditionellen Kultur, Freizeitgestaltung, eine verbesserte ländliche Kommunikationsstruktur, kooperative Dienstleistungen, den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen und eine regionale ökologische wirtschaftliche Entwicklung.
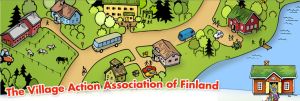 Als lockeres Netzwerk arbeiteten die Gruppen lange Zeit ohne eine feste Organisationsstruktur und verstand sich weniger als Projekt, denn als Bewegung. Während die Dorfaktivisten in der 'Dritten Welt' häufig das existentielle Überleben ländlicher Gemeinschaften zu sichern versuchten, ging es in Finnland darum, die Zerstörung kommunaler Strukturen zu verhindern und ein neues Selbstbewusstsein der Landbevölkerung zu fördern. "Das Problem liegt darin, dass die lokalen Behörden meist davon überzeugt sind, dass kleine Dörfer einfach keine Zukunft haben und dann entsprechende Entscheidungen fällen, sagt der finnische Aktivist Tapio Mattlar. "Wenn wir nichts dagegen tun, wird dieses Vorurteil wahr. Noch fließt das meiste Geld in die Städte und die Dörfer werden vergessen. Wir müssen beweisen, dass sie sich geirrt haben"
Als lockeres Netzwerk arbeiteten die Gruppen lange Zeit ohne eine feste Organisationsstruktur und verstand sich weniger als Projekt, denn als Bewegung. Während die Dorfaktivisten in der 'Dritten Welt' häufig das existentielle Überleben ländlicher Gemeinschaften zu sichern versuchten, ging es in Finnland darum, die Zerstörung kommunaler Strukturen zu verhindern und ein neues Selbstbewusstsein der Landbevölkerung zu fördern. "Das Problem liegt darin, dass die lokalen Behörden meist davon überzeugt sind, dass kleine Dörfer einfach keine Zukunft haben und dann entsprechende Entscheidungen fällen, sagt der finnische Aktivist Tapio Mattlar. "Wenn wir nichts dagegen tun, wird dieses Vorurteil wahr. Noch fließt das meiste Geld in die Städte und die Dörfer werden vergessen. Wir müssen beweisen, dass sie sich geirrt haben"
Der Prozess der emotionalen und kulturellen Rückbindung
Tatsächlich konnte die Bewegung die Landflucht in dem in relativ kurzer Zeit industrialisierten Land maßgeblich bremsen, indem sie sich in ehrenamtlichen Teams für die Attraktivität ihrer Region engagierten, Abwanderer zur Rückkehr aufforderten, den Fortbestand von Schulen und Postämtern organisierten und über zahlreiche Feste, Rituale, Kulturveranstaltungen und historischer Forschung die Beziehung zwischen den Menschen und dem Land stärkten. Frauen spielten eine zentrale Rolle in diesem Prozess der emotionalen und kulturellen Rückbindung und arbeiteten an der Entwicklung eine neuen Identität und Würde als moderne selbstbewusste und gut ausgebildete 'Landfrau', die sich nicht länger an der städtischen Yuppie-Gesellschaft zu orientieren brauchte.
Auch wenn das relativ reiche skandinavische Land sich nicht direkt mit Nationen wie Bangladesh vergleichen lässt, so zeigte sich doch, dass der Einfluss der globalisierten Wirtschaft auf die ländliche Entwicklung auch im oberen Drittel der Wohlstandsleiter ähnlich zerstörerisch war. Hier wie dort ging es darum, sich aus der Fremdbestimmung der Metropolen zu befreien und eine Gegenkultur aufzubauen, die sich nicht an den industriellen Konsumidealen orientierte, sondern am Gemeinwohl und den Grundbedürfnissen der Menschen.
Kooperierende Gemeinschaften statt konkurrierende Individuen
Schon haben Dritte Welt-Aktivisten wie der Inder M.P. Pareswaram (RLA 1996) auch Visionen einer fernen Zukunft entwickelt, in der zahllose dezentrale 'Dorfrepubliken' die Basis einer vielfältigen Weltgemeinschaft bilden könnten, die nicht länger auf konkurrierende Individuen, sondern auf kooperierende Gemeinschaften aufbaut. Auch wenn der Weg bis dahin weit erscheint, ist überall auf der Welt ein Anfang gemacht. Trotzdem gilt:
Gemeinschaften sind keine Modelle in dem Sinn von: "Alles nachmachen und die Welt wird gut". Keine hat den Stein der Weisen gefunden. Doch fast jede hat ein Splitter dieses Steins in der Hand. Und wer die Bruchstücke zusammensetzt, erhält einen Eindruck von einer möglichen und sehr lebenswerten Zukunft: Statt Globalisierung und Wirtschaftskrieg regionales kooperatives Wirtschaften, statt zunehmender Vereinzelung Rückkehr zum Leben in Gemeinschaft, statt Sinnkrise kulturelle Vielfalt und persönliches Wachstum. Und statt der Ökokatastrophe die Möglichkeit eines nachhaltigen Lebensstils mit weniger Konsum, gesunder Umwelt und Ernährung bei hoher Lebensqualität.
Mehr Informationen unter
www.village-action.fi
Quelle: Goethe Institut 2005
| Druckausgabe |